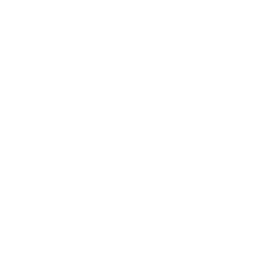Child Penalty: Mehr Aufklärung bei Frauen über die Altersvorsorge ist notwendig
Ein besserer Wissensstand über die Auswirkungen von Teilzeitarbeit führt dazu, dass Mütter ihre Pensen im Beruf erhöhen und so langfristig besser sozial abgesichert sind. Dies hat eine Studie der Ökonomin Michaela Slotwinski ergeben. Sie fordert deshalb, dass Frauen besser zur sozialen Absicherung informiert werden und hohe Arbeitspensen beibehalten.
Mit der Geburt des ersten Kindes bricht das Erwerbseinkommen von Frauen stark ein – vor allem, weil sie ihre Pensen reduzieren oder die Erwerbstätigkeit gar ganz aufgeben. Dieses Phänomen bezeichnen Forschende als Child Penalty. Im Gegensatz zu den Müttern arbeiten die meisten Väter weiter wie zuvor. Die Ökonomin und Assistenzprofessorin an der Universität Neuenburg Michaela Slotwinski forscht seit längerem zur Child Penalty. So hat sie beispielsweise anhand von Daten aus dem Kanton Bern untersucht, ob die Verfügbarkeit von Kitas die Child Penalty reduziert. Diese verringert sich zwar tatsächlich, bleibt aber weiterhin sehr gross.
Positive Effekte nachgewiesen
In ihrer neusten Studie hat Michaela Slotwinski Lehrerinnen mit Kindern nach den Gründen für ihre Teilzeitpensen befragt. So haben Frauen, welche zu Beginn noch zu wenig über die langfristigen Folgen von Teilzeitarbeit informiert waren, ihr Pensum um rund einen Halbtag pro Woche erhöht, nachdem sie die entsprechenden Informationen erhalten haben. Deshalb plädiert die Ökonomin dafür, das Interesse der Frauen für Fragen der sozialen Absicherung weiter zu wecken. «Diese Infos könnten abgegeben werden, wenn eine Frau eine neue Stelle beginnt oder ihrem Arbeitgeber mitteilt, dass sie Mutter wird», erklärt sie im Interview mit der Onlinepublikation des Bundesamts für Sozialversicherungen «CHSS».
Das Problem sind die tiefen Pensen
Laut Slotwinski sei eine Scheidung ein Riesenrisiko für Mütter. Weiter mahnt sie, dass sich ein höheres Pensum auch kurzfristig auszahlt – auch nach Abzug von Steuern und Kosten für die familienergänzende Bildung und Betreuung. Das Problem ist in der Schweiz daher nicht die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern, die mit 90 Prozent bereits sehr hoch ist, sondern es sind die tiefen Pensen. Populär ist daher die Forderung, die Betreuungsplätze zu vergünstigen, um die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu erhöhen. Obwohl laut Slowinski diese Effekte eher klein sind, ist sie dennoch überzeugt, dass diese zur Lösung beitragen können: «Wahrscheinlich gibt es auch nicht eine einzige Lösung, sondern man muss an vielen verschiedenen Rädchen drehen.»