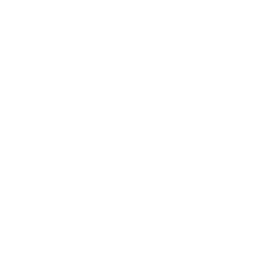Institutionelle Betreuung vor allem in den Grossstädten und in der Romandie verbreitet
Mehr als die Hälfte aller Schweizer Haushalte nutzt eine der drei Formen der institutionellen Bildung und Betreuung, wie eine Erhebung des Bundesamts für Statistik zeigt. Am häufigsten geschieht dies in den grössten Schweizer Städten und in der Westschweiz. Und obwohl die überwiegende Mehrheit der Mütter arbeitet, findet die Hälfte der Befragten, dass ein Kind im Vorschulalter unter der Berufstätigkeit der Mutter leidet.
In der Schweiz werden bei drei von vier Haushalten mit Kindern unter 13 Jahren die Kinder familienergänzend betreut. Mit 54 Prozent nutzen mehr als die Hälfte aller Haushalte die Formen der institutionellen Bildung und Betreuung, das heisst Kindertagesstätten, schulergänzende Tagesstrukturen oder Tagesfamilienorganisationen. Dies hat die Erhebung zu Familien und Generationen 2023 ergeben, die vom Bundesamt für Statistik als Teil des eidgenössischen Volkszählungssystems alle fünf Jahre durchgeführt wird.
Deutlicher Stadt-Land-Graben
Besonders häufig werden Kindertagesstätten und schulergänzende Tagesstrukturen in den sechs grössten Schweizer Städten, Basel, Bern, Genf, Lausanne, Winterthur und Zürich genutzt. Dort stützen sich 71 Prozent der Familien mit Kindern unter 13 Jahren auf diese Betreuungsformen. In den übrigen städtischen Gebieten liegt dieser Anteil mit 43 Prozent deutlich tiefer und in den ländlichen Gebieten ist er mit 33 Prozent nicht einmal halb so hoch. Dafür ist hier mit 47 Prozent die Betreuung durch die Grosseltern sowie mit 12 Prozent in Tagesfamilien verbreiteter als in den Grossstädten, wo die Anteile bei 26 beziehungsweise 6 Prozent liegen.
Klare Unterschiede bei den Sprachregionen
Die drei Sprachregionen sind ebenfalls verschieden. In der Romandie wird die familienergänzende Bildung und Betreuung in vier von fünf Haushalten mit Kindern unter 13 Jahren genutzt, während die Anteile in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz mit 73 und 65 Prozent tiefer liegen. Auch die institutionellen Betreuungsformen werden mit 72 Prozent in der Romandie deutlich öfter in Anspruch genommen als in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz, wo sie 48 beziehungsweise 44 Prozent betragen. Bei der Betreuung durch die Grosseltern gibt es dagegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Sprachregionen.
Erwerbstätigkeit der Mutter als Problem wahrgenommen
Aufschlussreich sind auch die Ergebnisse zu den Einstellungen zur Erwerbstätigkeit der Eltern. 77 Prozent der Befragten finden, dass ein Kind darunter leidet, wenn die Mutter zu viel arbeitet. Wenn dies aber der Vater tut, dann sind 69 Prozent der Umfrageteilnehmenden mit der Aussage einverstanden, dass das Kind darunter leidet. Im Einklang mit diesen Ergebnissen stimmt fast die Hälfte der Befragten zu, dass ein Kind im Vorschulalter unter der Berufstätigkeit seiner Mutter leidet – obwohl heutzutage die grosse Mehrheit der Mütter erwerbstätig ist. Bei den Männern liegt der Anteil mit 48 Prozent als bei den Frauen, wo er 42 Prozent beträgt.
Mütter kümmern sich um die kranken Kinder
Geschlechterunterschiede lassen sich auch bei der Frage feststellen, wie die Betreuung der Kinder unter den Eltern aufgeteilt wird. So sind mit 68 Prozent mehrheitlich die Mütter, die zu Hause bleiben, wenn Kinder krank sind. Andere Aufgaben wie die Kinder ins Bett bringen (68 Prozent) oder mit ihnen zu spielen (73 Prozent) werden dagegen von beiden Elternteilen übernommen.